Es gibt eine laufende Debatte darüber, ob die Dissoziative Identitätsstörung wirklich existiert, wie sie entsteht und ob sie nicht teilweise durch Therapie, Medien oder gesellschaftliche Erwartungen „verstärkt“ oder sogar „geschaffen“ wird. Die „Pro-DIS“-Seite argumentiert, dass neurowissenschaftliche Studien veränderte Hirnaktivitäten bei Menschen mit DIS im Vergleich zu gesunden Menschen oder anderen psychischen Störungen zeigen. Tatsächlich aber wurden diese veränderten Hirnaktivitäten auch bei der chronifizierten PTBS und bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung nachgewiesen. Im Folgenden zeige ich die Gemeinsamkeiten im Gehirn von DIS, BPS und kPTBS (früher chronische PTBS):
WeiterlesenAutor: Stella
Ist die DIS Subkultur eine Sekte?
Das bedeutet, dass Heilung nicht erwünscht ist, weil die Community nur funktioniert, solange die „Krankheit“ besteht. Jeder Zweifel wird als Gefahr gesehen, weil er das ganze Konzept ins Wanken bringen könnte. Aussteiger werden als „Feinde“ behandelt, selbst wenn sie vorher Teil der Gemeinschaft waren, was bereits einige Male dokumentiert wurde. Wer nicht mehr an die „multiple Wahrheit“ glaubt, wie sie unter anderem von Michaela Huber und anderen Netzwerk-Protagonisten jahrelang beschrieben wurde, verliert alles: Freunde, Identität und Zugehörigkeit. Das ist für viele Betroffene schlimmer als die psychische Erkrankung selbst.
WeiterlesenIst BPS eine Traumafolgestörung?
Es ist bekannt, dass ein hoher Anteil von Menschen mit BPS traumatische Erlebnisse in ihrer Kindheit gemacht hat. Studien belegen, dass etwa bis zu 96 % der Betroffenen von traumatischen Erfahrungen wie Vernachlässigung, psychischer, körperlicher oder sexueller Gewalt berichten. Traumata, die mit BPS in Zusammenhang stehen, umfassen jedoch nicht nur Missbrauch oder Vernachlässigung, sondern oft auch Bindungstraumata. Diese entstehen durch instabile, unsichere oder ambivalente Beziehungen zu primären Bezugspersonen, die tiefgreifende Auswirkungen auf die emotionale Regulation und die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung haben können.
WeiterlesenDIS vs BPS
Michaela Huber und ähnliche Stimmen haben sicherlich viel zur Sichtbarkeit von DIS beigetragen. Aber ihre Narrative – bewusst oder unbewusst – haben auch DIS glorifiziert und die Trennlinie vertieft. Das Tragische hierbei ist: Indem BPS (oder andere Traumafolgestörungen) nicht gleichwertig thematisiert werden, entsteht die Idee, dass DIS „echtes Trauma“ repräsentiert, während BPS oft als „instabile Persönlichkeit“ abgetan wird.
Diese – zumeist von Therapeuten hervorgerufene – Spaltung macht auch etwas mit Betroffenen. Anstatt sich solidarisch zu zeigen, entsteht eine Konkurrenz um „die schlimmste Diagnose“ – was den eigentlichen Schmerz nur vertieft. Das ist ein Kampf gegeneinander, den es unter Betroffenen einer Traumafolgestörung nicht geben darf. Auch der Selbstwert wird an die Diagnose gekoppelt. Wer eine DIS hat, fühlt sich „besonders“, wer BPS hat, fühlt sich „weniger wert“ – obwohl beide Diagnosen nur Wege sind, mit unfassbarem Leid umzugehen.
Monokultur in der Traumatherapie
Es ist durchaus erschreckend, dass sich in den letzten 30 Jahren so wenig in der Traumatherapie geändert hat. Dass ein solches Netzwerk, das auf fragwürdigen Grundlagen basiert, immer noch so viel Einfluss hat, zeigt, wie tief solche Strukturen verwurzelt sein können. Diese Stagnation hat durchaus fatale Folgen: Sie blockiert Innovationen, perpetuiert falsche Narrative und kann für Betroffene retraumatisierend wirken. Ein System, das sich so sehr auf alte Dogmen stützt, erstickt den Raum für Kritik und Fortschritt.
WeiterlesenRezension zum Interview über rituelle Gewalt
Abschließend reflektiert Harder über die Reaktionen auf den Podcast. Musyal berichtet, dass die Rückmeldungen überwiegend positiv waren und viele Menschen empört darüber seien, dass schädliche Therapien flächendeckend stattfinden und Menschen solches Leid erfahren müssen. Allerdings gab es auch kritische Stimmen, die weniger an einem inhaltlichen Austausch interessiert waren und oft Argumente von Institutionen wie der UKASK übernahmen. Musyal hebt hervor, dass in den Rückmeldungen häufig Glauben und Gefühle im Vordergrund standen, was verdeutliche, auf welch fruchtbaren Boden das Verschwörungsnarrativ falle.
WeiterlesenDIS und BPS – Eigenständige Diagnosen
Mittlerweile beginne ich zu erkennen, dass die DIS tatsächlich eine eigenständige Diagnose ist und nicht als Subtyp der BPS betrachtet werden sollte. Dies führt nun für mich persönlich zu einer Herausforderung: Wie kann ich diese Perspektive vertreten, ohne die elitäre Dynamik zu verstärken, die ich selbst als schädlich empfinde? Denn diese Hierarchien schaffen nicht nur Abgrenzung, sondern verhindern oft ein gegenseitiges Verständnis zwischen Betroffenen von Traumafolgestörungen.
WeiterlesenRichtungswechsel
Um den tatsächlichen Betroffenen zu helfen, ist es unerlässlich, die dissoziative Identitätsstörung von überzogenen und nicht evidenzbasierten Narrativen zu entkoppeln. Dies bedeutet nicht, dass die Erfahrungen der Betroffenen pauschal in Frage gestellt werden sollen. Vielmehr ist es notwendig, eine klare Linie zwischen wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und subjektiven Berichten zu ziehen, die großteils durch Gruppendynamiken oder externe Einflüsse geprägt sind.
Weiterlesen
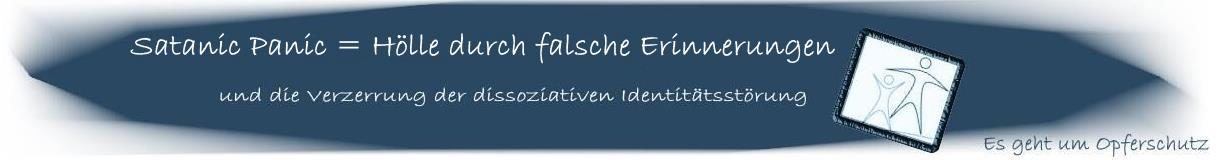
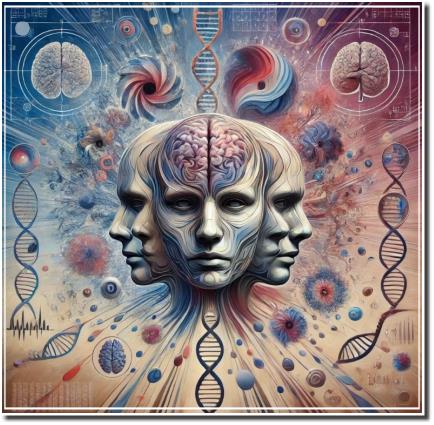

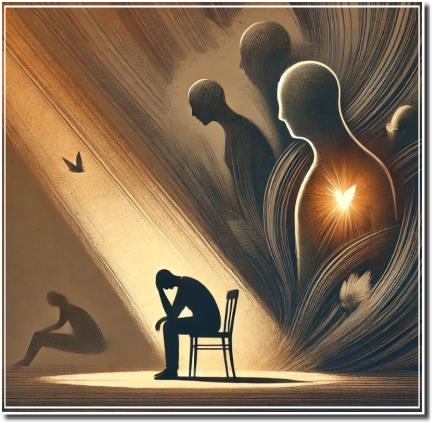







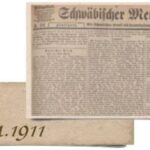

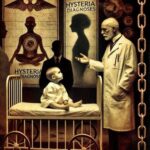
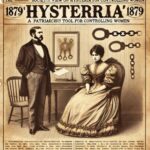
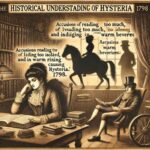
Neueste Kommentare