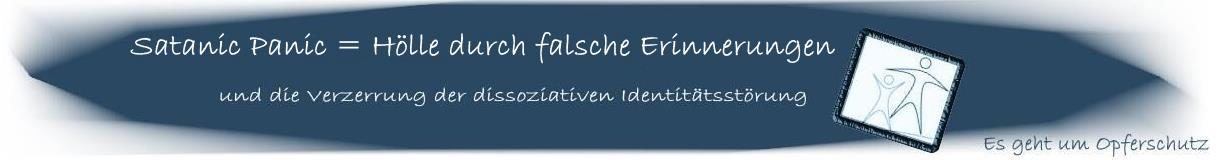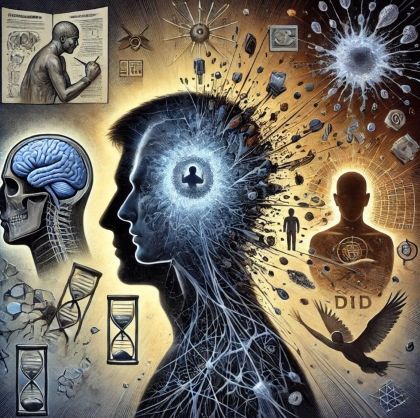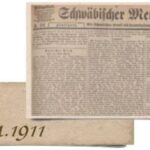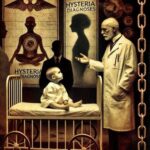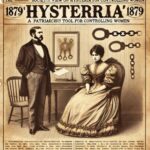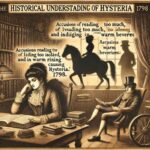Ich bin gerade dabei, einen Artikel über ein Interview zu schreiben, das vor klassischen Verschwörungs-Narrativen nur so strotzt. Mittendrin hielt ich inne. Als ich wieder einmal den Begriff „täterloyale Innenperson“ las, begann ich, mich an genau den Moment zu erinnern, als ich in den sozialen Medien Auskunft darüber gab, nicht mehr das RG-MC-Narrativ zu glauben. Das erste, was mir damals vorgeworfen wurde, war, dass nicht „ICH“ so etwas sage, sondern eine täterloyale Person.
Und da sind wir bereits bei dem ersten Punkt, der mich dazu bringt, einen aufklärerischen Artikel über diese unsinnige Begrifflichkeit zu schreiben. Dieses Konstrukt von „täterloyalen Innenpersonen“ ist nicht nur falsch, sondern es wird auch als Waffe genutzt. Sobald jemand anfängt, kritisch zu hinterfragen, wird nicht mit Argumenten geantwortet – sondern mit einer pathologisierenden Unterstellung. Das ist ein perfider Manipulationstrick! Damit wird sichergestellt, dass niemand aus diesem Denksystem ausbrechen kann, denn jede Form von Zweifel oder Kritik wird als Beweis für die eigene Täterschaft gewertet. Das ist keine Psychologie – das ist eine sektenartige Dynamik.
Doch kommen wir nun zu der faktenbasierten Aufklärung
Für dieses problematische Konstrukt „täterloyale Innenpersonen“ – das von der RG-Szene oft als mystifiziertes Konzept dargestellt wird – gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. Was es aber gibt: Es gibt sehr wohl psychologische Mechanismen, die erklären, warum manche Menschen misshandelnde Täter in Schutz nehmen, was allerdings nichts mit „abgespaltenen Innenpersonen“ zu tun hat.
Bindungstheorie – das Stockholm-Syndrom im eigenen Zuhause.
Kinder sind evolutionär darauf programmiert, sich an ihre primären Bezugspersonen zu binden – selbst wenn diese gewalttätig oder missbräuchlich sind. In der Kindheit bedeutet Bindung
Überleben – denn ohne Bezugsperson ist ein Kind hilflos. Wenn ein Elternteil Gewalt ausübt, befindet sich das Kind in einem emotionalen Konflikt: „Ich brauche dich zum Überleben – aber du tust mir weh.“ Das Gehirn löst diesen Konflikt oft so, dass es die Gewalt rationalisiert:
- „Wenn ich mich mehr anstrenge, werde ich geliebt.“
- „Mama/Papa meint es nur gut.“
- „Ich bin selbst schuld.“
Dieses Phänomen wird als „traumatische Bindung“ bezeichnet und ist KEIN Anzeichen für eine DIS oder „täterloyale Innenpersonen“.
Kognitive Dissonanz – Die Psyche sucht nach Harmonie
Menschen können nicht gleichzeitig denken „Meine Mutter liebt mich“ und „Meine Mutter schlägt mich, weil sie mich hasst“. Also sucht das Gehirn nach einer „Lösung“, die weniger schmerzhaft ist:
- „Sie macht das nur, weil sie selbst leidet.“
- „Mama schlägt mich nicht, weil sie böse ist – sondern weil ich es verdient habe.“
Diese Umdeutung verringert das psychische Leid – führt aber dazu, dass Täter in Schutz genommen werden.
Trauma-Überlebensmechanismen – Schutz durch Anpassung
Für misshandelte Kinder ist es oft sicherer, sich mit dem Täter zu identifizieren oder ihn zu verteidigen. Wenn ein Kind ständig in Angst lebt, ist die Psyche darauf ausgelegt, die Situation so erträglich wie möglich zu machen. Das bedeutet manchmal: Sich dem Täter emotional anzunähern, anstatt Widerstand zu leisten.
- „Wenn ich mich Mama/Papa anpasse, tut es weniger weh.“
- „Wenn ich ihn/sie verteidige, dann bleibt unser ‚Familienfrieden‘ bestehen.“
Das ist ein Überlebensmechanismus – keine dissoziierte Identität!

Die oben beschriebenen Mechanismen sind bewusste oder halbbewusste Anpassungsstrategien. Menschen mit Trauma reagieren unterschiedlich – aber sie brauchen keine dissoziierte Identität, um einen Täter zu verteidigen. Das Problem dabei ist, dass diese Konstruktion normale Trauma-Reaktionen pathologisiert. Sie erweckt den Eindruck, als sei das Opfer komplett ferngesteuert – dabei sind es ganz normale Bindungs- und Schutzmechanismen.
Der RG-MC Szene geht es allerdings nicht darum, die Normalität einer psychischen Abwehrreaktion zu unterstreichen, sondern das Konstrukt als universellen Joker einzusetzen.
- „Du glaubst nicht an rituelle Gewalt? Dann spricht gerade deine täterloyale Innenperson.“
- „Du erinnerst dich nicht an den Missbrauch? Dann hat deine täterloyale Innenperson die Erinnerungen blockiert.“
Oder es dient als Vorwand für ein Verhalten, das nicht sozial ist:
- Das war nicht mein Handeln, sondern das einer „täterloyalen Innenperson“.
- Auf dieses Verhalten habe ich keinen Einfluss; ich bin dem selbst schutzlos ausgeliefert.
- Ich würde dir niemals schaden, es war dieser täterloyale Anteil = eine Täterin/ein Täter.
So etwas macht jegliche zwischenmenschliche Kommunikation unmöglich, weil jede Konsequenz ins Leere läuft. Obendrein schafft es ein giftiges Machtgefälle.
- „Ich kann nichts dafür, wenn ich dich verletze – aber du musst mich trotzdem so akzeptieren, wie ich bin.“
- „Wenn du mich kritisierst, dann bist du ableistisch oder greifst eine Innenperson an.“ (← Das passiert leider immer öfter!)
Das führt dazu, dass Menschen mit echter DIS irgendwann wie tickende Zeitbomben wahrgenommen werden, weil niemand weiß, wann „ein Täteranteil die Kontrolle übernimmt“.
Was ich persönlich auch als extrem schwierig empfinde, ist die laute Forderung danach, dass sich die Gesellschaft anzupassen habe und dass man dieses Verhalten als „krankheitsbedingt“ akzeptieren müsse. Das setzt automatisch eine ungesunde Dynamik in Gang. Denn dann muss die Umwelt mitspielen – selbst wenn das Verhalten toxisch, manipulativ oder schädlich ist. Wer nicht „mitspielt“, wird als Täter abgestempelt.
Folgen:
DIS wird nicht mehr als behandelbare Störung betrachtet, sondern als ein unantastbares Identitätsmerkmal. Aber genau das verstärkt die Stigmatisierung. Wenn Menschen keine Möglichkeit mehr haben, sich mit DIS-Betroffenen auf einer normalen sozialen Ebene auseinanderzusetzen, entsteht ein Graben – und genau das ist das Gegenteil von Akzeptanz und Integration.