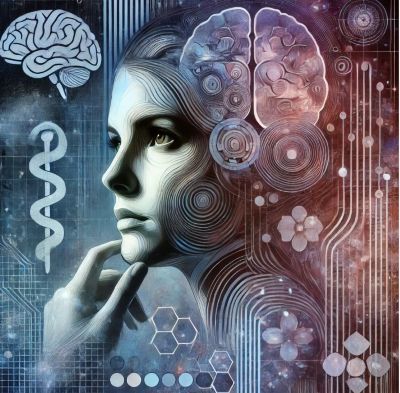Gilt die Hysterie heute als veraltetes Wissen, das keine Relevanz mehr hat? Oder anders gefragt: Hat sich das Krankheitsbild der Hysterie in Luft aufgelöst, nur weil der Begriff aus der medizinischen Klassifikation verschwunden ist?
Es fällt auf, dass nicht nur der Begriff „Hysterie“ gemieden wird – vermutlich auch, weil er in der Alltagssprache abwertend verwendet wird –, sondern auch die gesamte klinische Thematik dahinter. Doch kann man wirklich die „alte“ und die „neue“ Schule der Psychiatrie so strikt voneinander trennen? Oder ist Hysterie in einer anderen Form noch immer präsent?
Der Begriff lebt weiter – in anderen Diagnosen
Der renommierte Psychiater und Psychotherapeut Birger Dulz verwendet noch heute den Begriff „hysteroid“, abgeleitet von der historischen Hysterie-Diagnose. So heißt es im Handbuch der Borderline-Störungen:
Insgesamt rechne ich Borderline Patienten mit multiplen Persönlichkeitszuständen den Borderline-Störungen auf hysteroidem Symptom-Niveau zu.
Dulz, Herpertz, Kernberg, Sachsse: Handbuch der Borderlinestörung, 2011, S. 435
Auch in der Traumatherapie wird häufig auf Pierre Janet verwiesen, einen der wichtigsten Begründer des Dissoziationskonzepts. Doch was oft unerwähnt bleibt: Janet sah Dissoziation als eine Form der Hysterie. Er schrieb 1893:
„Das Wort Hysterie sollte beibehalten werden, auch wenn seine ursprüngliche Bedeutung (der Bezug zur Gebärmutter) sich so sehr gewandelt habe. Es ist schwierig, es heute zu ändern; in der Tat hat es eine so große und so schöne Vergangenheit, dass es schmerzlich wäre, es aufzugeben.“
(Pierre Janet: État mental des hystériques, Paris, 1893, zit. n. Stavros Mentzos: Hysterie. Zur Psychodynamik unbewusster Inszenierungen, 2012, S. 16)
Es ist eine bemerkenswerte Ironie, dass viele, die sich auf Janet berufen, sich gleichzeitig von der Hysterie-Diagnose distanzieren. Was würde er wohl heute dazu sagen?
Hysterie als historisches Stigma – und ihr unterschätztes Potenzial
Der Begriff „Hysterie“ hat im Laufe der Jahrzehnte eine Stigmatisierung erfahren. In der heutigen Alltagssprache steht er für Begriffe wie „unecht“, „theatralisch“, „übertrieben“ oder „unsachlich“. Doch schon Stavros Mentzos stellte fest:
„Zwar enthält Hysterisches vieles, was mit übertriebener Emotionalität, Dramatisierung, Theatralik und Unechtheit bezeichnet werden kann, aber in einem ganz anderen Zusammenhang, als es der moralisch abwertende Gebrauch des Wortes impliziert. Ein bewusst gewolltes, ein absichtlich unechtes und prätentiöses Verhalten als hysterisch zu bezeichnen ist genauso unsinnig wie widersprüchliches Verhalten ohne weiteres mit schizophren gleichzusetzen.“
(Stavros Mentzos: Hysterie. Zur Psychodynamik unbewusster Inszenierungen, 2012, S. 15)
Trotz der Stigmatisierung gab es historisch auch eine andere Sichtweise auf Hysterie. So schreiben Dulz, Kernberg et al.:
„Man findet unter den Hysterischen die geistig klarsten, willensstärksten, charaktervollsten und kritischsten Menschen.“
(Dulz, Herpertz, Kernberg, Sachsse: Handbuch der Borderlinestörung, 2011, S. 435)
Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim, besser bekannt als „Anna O.“ – eine der bekanntesten Patientinnen von Josef Breuer und Sigmund Freud. Nach ihrer Therapie setzte sie sich intensiv für Frauenrechte und soziale Reformen ein. Sie war eine treibende Kraft hinter Bewegungen, die Frauen aus der Prostitution befreien sollten – eine beachtliche Leistung für eine Frau ihrer Zeit.
Die moderne Psychiatrie – Ein neues Gewand für die Hysterie?
Heute existieren zahlreiche Diagnosen, die auf das Phänomen der Hysterie zurückgeführt werden können: Konversionsstörungen, Dissoziationen, dissoziative Erscheinungen, Ich-Spaltungen (einschließlich der Dissoziativen Identitätsstörung), Amnesien, Halluzinationen (die nicht der Schizophrenie zugeordnet werden können), Pseudodepressionen, Dämmerzustände, Pseudodemenzen und histrionische Persönlichkeitsstörungen – all diese Störungen zeigen Elemente, die einst als Hysterie klassifiziert wurden.
Kein Mensch entscheidet sich freiwillig dafür, monate- oder jahrelang an Sehstörungen, Lähmungen oder anderen psychosomatischen Beschwerden zu leiden. Doch genau das sind klassische Symptome der Konversionsstörungen, die bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt werden können.
Warum lehnen ausgerechnet DIS-Betroffene den Begriff Hysterie ab?
Ein interessanter Aspekt ist, dass ausgerechnet viele Menschen, die heute unter der Dissoziativen Identitätsstörung leiden, den Begriff „Hysterie“ als abwertend empfinden. Doch warum? Ist es nicht bemerkenswert, dass gerade die Menschen, deren Symptomatik aus dem Konzept der Hysterie entstanden ist, sich davon distanzieren?
Darin könnte ein Abwehrmechanismus liegen – ein Versuch, sich von der historischen Stigmatisierung der Hysterie zu lösen. Doch hilft es wirklich, die Ursprünge der eigenen Symptomatik zu ignorieren? Oder wäre es nicht sinnvoller, sich mit der Geschichte der eigenen Diagnose auseinanderzusetzen, um ein umfassenderes Verständnis zu gewinnen?
Die Hysterie mag aus der medizinischen Nomenklatur verschwunden sein, doch ihre Konzepte leben in zahlreichen modernen Diagnosen weiter. Die Frage ist also nicht, ob Hysterie „echt“ war oder nicht – sondern warum sie umbenannt wurde und welche gesellschaftlichen Mechanismen dahinterstehen.
Das Stigma der Hysterie darf nicht dazu führen, dass wir ihre reale Existenz und ihren Einfluss auf heutige psychiatrische Diagnosen ignorieren. Es ist an der Zeit, sich mit diesem verdrängten Kapitel der Psychiatriegeschichte kritisch auseinanderzusetzen.